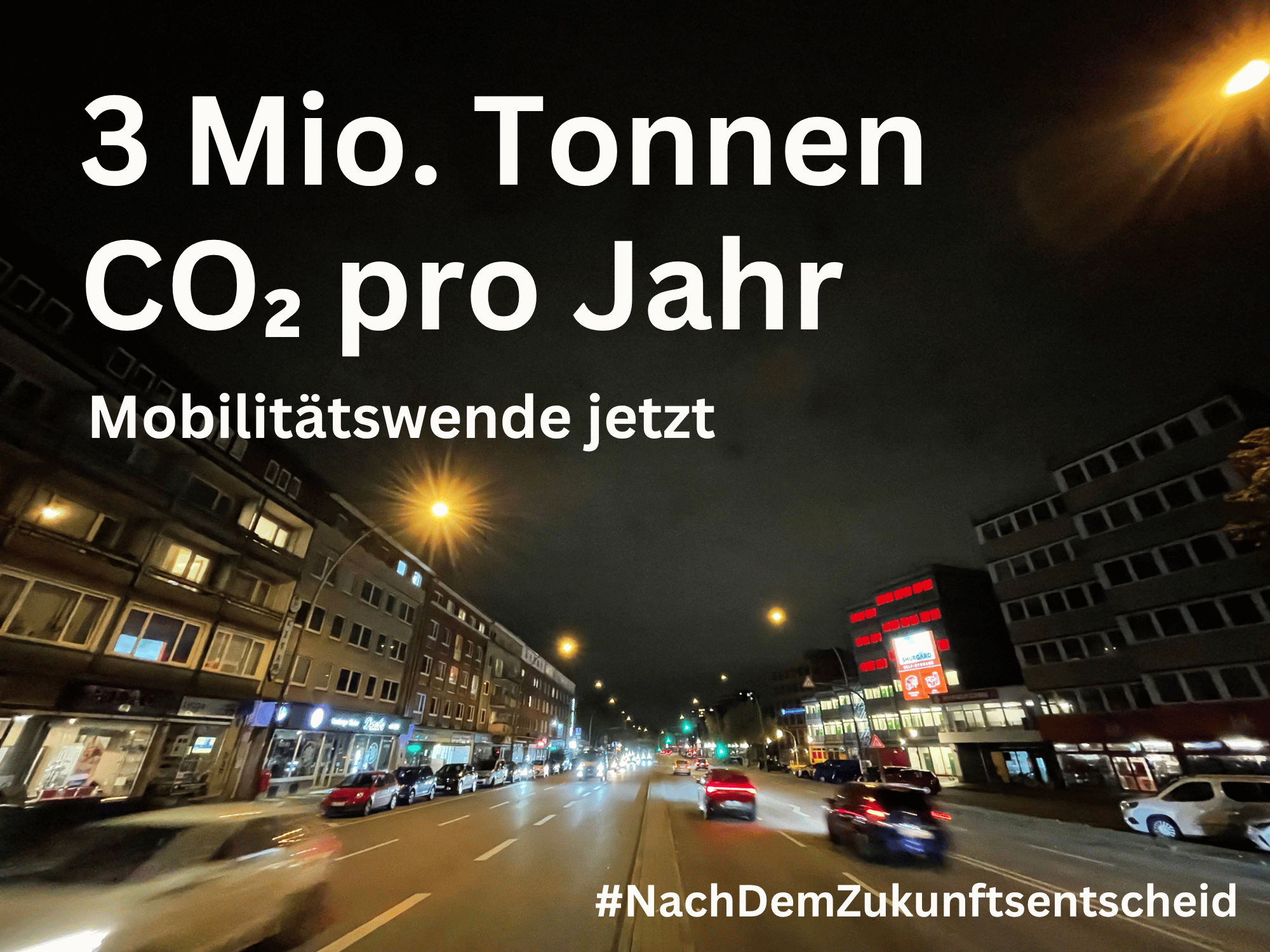TL;DR
Ab 2026 gelten in Hamburg erstmals verbindliche CO₂-Grenzwerte für alle Sektoren – inklusive Verkehr. Überschreitet die Stadt diese Zielmarken, ist der Senat gesetzlich verpflichtet, innerhalb von fünf Monaten ein Sofortprogramm zu beschließen. Diese Pflicht ist einklagbar: Umweltverbände oder Betroffene können vor Gericht erzwingen, dass Hamburg handelt. Doch Bürgermeister Tschentscher will bis 2030 an den bisherigen Plänen festhalten – entgegen dem neuen Gesetz. Damit riskiert der Senat, schon 2026 gegen geltendes Klimarecht zu verstoßen.
#NachDemZukunftsentscheid
1. Das Gesetz gilt sofort – nicht erst 2030
Mit dem Hamburger Zukunftsentscheid stimmten am 12. Oktober 2025 die Hamburgerinnen und Hamburger per Volksentscheid über das Klimaschutzverbesserungsgesetz zu Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes (HmbKliSchG) ab. 303.936 Wahlberechtigte stimmten für das Gesetz. Das neue Klimaschutzgesetz tritt damit innerhalb eines Monats nach dieser Entscheidung in Kraft.
Ab 2026 gelten erstmals gesetzlich festgelegte CO₂-Grenzwerte für jedes Jahr. Diese Jahresbudgets bestimmen, wie viel Treibhausgas Hamburg insgesamt noch ausstoßen darf. Die BUKEA (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft) muss dazu jährlich zum 30. Juni eine Bilanz vorlegen, die zeigt, ob die Stadt ihre Zielmarken einhält. Wird ein Grenzwerte überschritten, ist der Senat verpflichtet, innerhalb von fünf Monaten ein Sofortprogramm zu beschließen – verbindlich und gerichtlich einklagbar. Bleibt der Senat untätig, verschiebt sich das Defizit in die Folgejahre.
Die erste Bilanz betrifft das Jahr 2025. Sie wird turnusgemäß bis zum 30. Juni 2026 von der BUKEA vorgelegt. Da für 2025 noch keine gesetzlichen Grenzwerte gelten, hat sie keine direkten Folgen – sie dient der Vorbereitung auf die ab 2026 verbindlichen Zielwerte. Dies darf aber nicht als Einladung zur Untätigkeit verstanden werden:
Wer 2026 einhalten will, muss jetzt beginnen – denn: Die erste Zielgröße liegt fest: Hamburg darf 2026 maximal 9,6 Mio. t CO₂ ausstoßen. Danach sinkt das Budget jährlich um rund 0,87 Mio. t CO₂ (≈ 870.000 t CO₂) bis 2040. (vgl. Anlage 3 HmbKliSchG)
Rechtlich zählt die Gesamtsumme der Emissionen. Damit der Reduktionspfad aber eingehalten werden kann, müssen alle Sektoren beitragen. Für den Straßenverkehr ist die Herausforderung besonders groß: In der Verursacherbilanz 2023 liegt der Straßenverkehr bei 2,958 Mio. t CO₂/Jahr (≈ 8 103 t/Tag). Zur Orientierung: Das entspricht ≈ 23,6 % der städtischen Gesamtemissionen in Höhe von 12,532 Mio. t CO₂/Jahr in 2023 (vgl. Statistikamt Nord 2023, […] (Verursacherbilanz) in Hamburg 2023 – Straßenverkehr)
Legt man für 2026 das Gesamtbudget 9,611 Mio. t CO₂ zugrunde und setzt den Anteil des Straßenverkehrs mit ≈ 23,6 % an, ergibt sich ein Richtwert von ≈ 2,269 Mio. t CO₂/Jahr (≈ 6 216 t/Tag). Unter der Annahme, dass sich der Stand 2025 nicht wesentlich von 2023 (2,958 Mio. t) unterscheidet, muss der Straßenverkehr bis 2026 rund 689.000 t CO₂ (≈ 23,3 %) abbauen (≈ -1 889 t/Tag); bleibt diese Reduktion aus, verfehlt Hamburg sehr wahrscheinlich seine gesetzlichen Vorgaben. Diese Annahme ist plausibel, weil der Straßenverkehr von 2022 (3,031 Mio. t) auf 2023 (2,958 Mio. t) nur um ≈ 2,4 % sank. Bis zur Schätzbilanz 2025 (fällig 30.06.2026) gibt es aktuell keine Anzeichen für eine strukturelle Trendumkehr, die den Reduktionsbedarf 2026 substanziell verringern würde.
Die Pflicht ist rechtlich bindend. Wird kein Sofortprogramm beschlossen, kann die Stadt auf dessen Erlass verklagt werden. Klagebefugt sind Umweltverbände, Initiativen und betroffene Bürgerinnen und Bürger. Damit wird aus einem politischen Ziel erstmals ein einklagbares Recht.
2. Was der Senat plant – und was er blockiert
Am Tag nach dem Volksentscheid erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher:
„Das Ziel des Senats und die bisherige gesetzliche Vorgabe, dass Hamburgs CO₂-Emissionen im Vergleich zu 1990 bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent reduziert werden sollen, bleibt allerdings unverändert. Das ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil der Volksentscheid dadurch nicht zu kurzfristigen neuen Maßnahmen führt, sondern der Senat die bestehenden Planungen für die aktuelle Legislatur grundsätzlich unverändert fortführen kann.“
Quelle: hamburg.de
Damit setzt Tschentscher faktisch die Umsetzung des nun gültigen Klimaschutzgesetzes aus. Der Koalitionsvertrag der laufenden Legislatur wurde vor dem Volksentscheid verhandelt; das Festhalten an unveränderten Planungen bedeutet im Ergebnis Stillhalten.
Relevante Punkte in der Verkehrspolitik des Senats/Koalitionsvertrags:
- Keine neuen Tempolimits über bestehende Zonen hinaus.
- Parkplatzmoratorium verhindert weitestgehend Flächenumverteilung zugunsten des Umweltverbunds.
- Fokus auf langwierige Tunnelprojekte (U5, S4, S6), die erst nach 2040 Wirkung entfalten.
- Kein Sofortprogramm Verkehr, keine beschleunigten Maßnahmen für 2026 ff.
Das ist politisch bequem, aber juristisch riskant. Ab 2026 muss Hamburg nachweisen, dass der lineare Reduktionspfad eingehalten wird. Bleibt der Senat untätig, verstößt er gegen eine gesetzliche Handlungspflicht.
3. Was die Gutachten empfehlen – und was 2026 wirklich nötig ist
Die Umweltbehörde (BUKEA) hat 2025 ein Machbarkeitsgutachten zur Klimaneutralität bis 2040 vorgelegt und aktualisiert. Darin wird der Verkehr für 2040 als größter verbleibender Emittent ausgewiesen (≈ 598 Tsd. t CO₂). Zugleich empfiehlt die BUKEA zusätzliche wirkmächtige Instrumente, insbesondere im Verkehr, um den Zielpfad zu halten.
Aus den Gutachten leiten sich Soforthebel ab, die kurzfristig planbar oder umsetzbar sind. Die folgende Auswahl ordnet Hebel – Maßnahme – Wirkung – Startfenster.
| Hebel | Maßnahme | Wirkung | Umsetzbar ab |
|---|---|---|---|
| Elektrifizierung / Regulatorik | Einführung einer Null-Emissions-Zone (Start im Kerngebiet, z. B. Ring 1, stufenweise Ausweitung) zur Beschleunigung der Antriebswende | sehr hoch | ab 2026 planbar (Rechtsrahmen nötig) |
| Verlagerung | Beschleunigter Ausbau Bus/ÖPNV (Hamburg-Takt) und Radinfrastruktur; flächig Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit; Flächenumverteilung | hoch | sofort – Beschleunigung erforderlich |
| Ladeinfrastruktur | Dichtes Netz öffentlicher, privater und gewerblicher Ladepunkte; schnellere Genehmigungen und Netzertüchtigung | mittel – hoch (Enabler) | ab 2025 laufend |
| Car-Sharing | Vorgabe CO₂-neutraler Antriebe für Car-Sharing-Flotten; Ausbau HVV-Switch | mittel | 2026 – 2028 |
| Straßengüterverkehr | Lade- / H₂-Infrastruktur an Umschlagplätzen (insb. Hafen); Priorisierung emissionsfreier Lkw bei der Abfertigung | hoch | 2026 – 2029 |
„Für die Erreichung der Klimaneutralität bereits im Jahr 2040 wären zusätzliche wirkmächtige Instrumente und Maßnahmen zur Emissionsreduktion erforderlich – insbesondere im Bereich Verkehr.“
Quelle: BUKEA – Machbarkeitsgutachten 2040 (09/2025)
Kurz gesagt: Ohne unverzüglich einsetzende und beschleunigte Maßnahmen im Verkehr – vom Infrastrukturausbau bis zur Antriebswende – verfehlt Hamburg den vorgesehenen Pfad; der Verkehrssektor bliebe der zentrale Restemittent. Dies steht im Widerspruch zur politischen Linie, die bis 2030 an unveränderten Planungen festhält – siehe oben.
4. Was jetzt passieren muss – 2026 als Testjahr
2026 ist das Testjahr: Damit das Jahresbudget eingehalten und ein Sofortprogramm vermieden wird, braucht es kurzfristig wirksame Maßnahmen im Verkehr – stadtweit, nicht nur im Zentrum. Gerade in den äußeren Gebieten entscheidet sich, ob die Mobilitätswende gelingt. Dort fehlt bislang u.a. sichere Rad- und solide Businfrastruktur.
Beispiel für Maßnahmen, die sich unverzüglich auf den Weg bringen ließen:
a) Verkehrsflächen umwidmen
- Pop-up-Busspuren auf allen Hauptachsen in Hamburg.
- Pop-up-Radspuren mit baulicher Abtrennung.
- Parkplatzmoratorium aufheben, Flächen umnutzen.
b) Tempo & Emissionen
- Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit – so weit rechtlich möglich.
- Zero-Emission-Zone I (City-Ring 1): Zulassung nur für E-Fahrzeuge ab 2028.
c) Öffentlicher Verkehr
- Bus Rapid Transit (BRT) als Ergänzung zu den laufenden U- und S-Bahn-Projekten.
- Taktverdichtung im HVV – mehr Angebote, kürzere Wartezeiten.
Diese Schritte sind relativ kurzfristig realisierbar und rechtlich als „geeignete Maßnahmen“ zu verstehen. Sie stammen nicht aus dem Volksentscheid selbst, sondern ergeben sich u.a. aus den BUKEA-Gutachten und der gesetzlichen Reduktionslogik.
5. Warum 2025-2026 entscheidend ist
2026 ist die Bewährungsprobe. Erstmals nach dem Zukunftsentscheid muss Hamburg die Einhaltung des Jahresbudgets belegen. Von 2025 auf 2026 braucht es nachweisbar wirksame Schritte. Ohne wirksame Maßnahmen in 2026 drohen:
- Ein gerichtlich erzwungenes Sofortprogramm,
- Vertrauensverluste in die Wirksamkeit der Volksgesetzgebung,
- deutlich teurere Nachsteuerungen in späteren Jahren.
Das Zeitfenster ist eng: Nicht 2040 entscheidet sich, ob Hamburg klimaneutral wird – 2026 entscheidet, ob Hamburg den Weg dorthin überhaupt antritt.
Das sagt Verkehrsexperte Christian Hinkelmann (nahverkehrhamburg.de) dazu:
„Der Senat steht nun in der Verantwortung. Es erfordert Mut, jetzt umzusteuern und die langwierigen Großprojekte durch schnelle, pragmatische Lösungen zu ergänzen. Die Alternative ist ein Festhalten an den bisherigen Plänen – und damit die wissentliche Inkaufnahme, dass Hamburgs Autofahrer im nächsten Jahrzehnt mit drastischen Verboten und Einschränkungen konfrontiert werden.
Die Weichen für die Härte der kommenden Maßnahmen werden nicht erst 2030 gestellt, sondern heute.“
Quelle: nahverkehrhamburg.de
Rechtlicher Exkurs: Was passiert, wenn Hamburg nicht handelt
Mit dem Zukunftsentscheid hat Hamburg das Klimaziel erstmals justiziabel gemacht. Das ist der eigentliche Sprengsatz des neuen Gesetzes: Klimaschutz ist jetzt nicht mehr politische Absichtserklärung, sondern gesetzliche Pflicht mit Handlungspflicht.
1. Die Verpflichtung
Die jährliche Schätzbilanz wird nach § 4 Abs. 4 HmbKliSchG von der zuständigen Behörde (BUKEA) bis zum 30. Juni des Folgejahres vorgelegt. Sie folgt der amtlichen Methodik der Verursacherbilanz (Statistikamt Nord, Energie- und CO₂-Bilanzen für Hamburg – siehe oben).
Die neue Fassung des § 4 Abs. 5 HmbKliSchG lautet:
„Weist die Schätzbilanz eine Überschreitung der zulässigen Jahresemissionsgesamtmenge des vergangenen Kalenderjahres aus, beschließt der Senat innerhalb von fünf Monaten nach Vorlage der Schätzbilanz nach Absatz 4 Maßnahmen, die geeignet sind, die Überschreitung der Jahresemissionsgesamtmenge auszugleichen (Sofortprogramm).“
Diese Formulierung („beschließt … innerhalb von fünf Monaten“) ist eine echte Handlungspflicht. Sie ist nicht politisch, sondern rechtlich verbindlich und unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Anders als frühere Klimaziele ist sie nicht bloß programmatisch, sondern vollziehbar formuliert – mit Frist, Handlung und Adressat.
Ein Sofortprogramm ist damit ein beschlossenes Maßnahmenpaket mit 5-Monats-Frist und Eignungsmaßstab der Maßnahmen; es besteht Gestaltungsspielraum, aber kein Null-Handlungsspielraum.
2. Wer klagen kann
Die wichtigste Frage: Wer kann durchsetzen, dass Hamburg handelt? Es gibt drei mögliche Wege:
- Verbandsklage (§ 2 Abs. 1 UmwRG, Umweltrechtsbehelfsgesetz)
- Umweltverbände wie BUND, NABU, Deutsche Umwelthilfe oder andere anerkannte Organisationen können gegen Unterlassungen von Behörden klagen, wenn eine rechtliche Pflicht zum Handeln besteht.
- Voraussetzung: Die Maßnahme (oder das Unterlassen) betrifft Umweltrecht im Sinne des § 1 UmwRG – das Klimaschutzgesetz gilt darunter.
- Beispiel: BUND vs. Bundesregierung (Berlin, 2021) – Klage auf Umsetzung des Bundes-Klimaschutzgesetzes; das Gericht verpflichtete das Bundesministerium, Sofortprogramme vorzulegen.
- Übertragbar auf Hamburg: Wenn der Senat bis Ende 2027 kein Sofortprogramm beschließt, können Verbände auf Erlass eines Sofortprogramms klagen.
- Individualklage (Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO)
- Einzelpersonen können nur klagen, wenn sie selbst betroffen sind – etwa, wenn ein Sofortprogramm rechtswidrig unterbleibt und sie dadurch in einem subjektiven öffentlichen Recht verletzt sind.
- Das ist bei Klimafragen selten gegeben, aber nicht ausgeschlossen (vgl. Bundesverfassungsgericht 2021: Grundrecht auf intergenerationelle Freiheitssicherung).
- In der Praxis schwierig, aber möglich, wenn Betroffene nachweisen können, dass fehlender Klimaschutz ihre Grundrechte beeinträchtigt (z. B. Gesundheit, Eigentum, Art. 2 GG).
- Organstreit (Bürgerschaft / Opposition)
- Abgeordnete oder Fraktionen können die Regierung auf Verstoß gegen geltendes Landesrecht verklagen, falls der Senat seiner Pflicht nicht nachkommt.
- Hamburgs Verfassung erlaubt Organstreitverfahren vor dem Hamburgischen Verfassungsgerichtshof.
- Politisch jedoch unwahrscheinlich, solange SPD und Grüne gemeinsam regieren.
3. Was realistisch passiert, wenn der Senat nichts tut
Wenn die Schätzbilanz 2026 (fällig Sommer 2027) eine Überschreitung des Budgets von 9,6 Mio. t CO₂ ausweist, dann gilt:
- Szenario A (Sofortprogramm) – der Senat beschließt binnen fünf Monaten ein Sofortprogramm:
- Eignung/Wirksamkeit: Es muss plausibel darlegen, wie die Maßnahmen den Ausgleich erreichen. Gerichtlich überprüfbar ist der Eignungsmaßstab, nicht die politische Zweckmäßigkeit.
- Nachsteuerung: Führt das Paket nicht zum Ausgleich, sind weitere oder schärfere Maßnahmen nachzuschieben.
- Szenario B (kein Sofortprogramm) – unterbleibt der Beschluss, können anerkannte Umweltverbände per Verpflichtungsklage (§ 42 VwGO) den Erlass eines Sofortprogramms beantragen.
- Das Gericht prüft Pflichtverletzung und hinreichende Bestimmtheit.
- Eilrechtsschutz ist möglich; Gerichte können Auflagen zur Nachbesserung setzen.
Im Erfolgsfall würde das Gericht Hamburg verpflichten, ein Sofortprogramm zu beschließen – nicht dessen Inhalt, aber den Beschluss selbst. Genau so hat das OVG Berlin-Brandenburg am 30.11.2023 die Bundesregierung verurteilt:
„Die Beklagte wird verurteilt, […] ein Sofortprogramm […] zu beschließen, welches Maßnahmen enthält, die die Einhaltung der Jahresemissionsmengen der Sektoren Gebäude und Verkehr […] für die Jahre 2024 bis 2030 sicherstellen.“
Quelle: OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.11.2023, OVG 11 A 1/23
4. Wann eine Klage Aussicht auf Erfolg hätte
Eine Klage hätte Aussicht auf Erfolg wenn
- die Emissionen 2026 über 9,611 Mio. t CO₂ liegen (sehr wahrscheinlich),
- der Senat kein Sofortprogramm bis November 2027 beschließt,
- und die Überschreitung nicht auf Bundeskompetenzen allein zurückgeführt werden kann (was im Verkehrssektor schwierig wäre, da Hamburg eigenständige Kompetenzen für Straßen- und Verkehrsrecht hat).
Gerichte prüfen dabei nicht politische Zweckmäßigkeit, sondern Pflichtverletzung. Das bedeutet: Wenn Hamburg untätig bleibt, kann ein Gericht den Senat zum Handeln zwingen.
5. Fazit des Exkurses
Im Klimagesetz steht kein „müsste“, sondern ein „muss“ – es handelt sich also um eine echte Handlungspflicht mit Rechtsfolge. Der Unterschied zu früher ist fundamental: Ab 2026 wird Hamburgs Klimapolitik juristisch messbar und einklagbar. Und wenn der Senat seiner Pflicht nicht nachkommt, kann die Zivilgesellschaft über den Rechtsweg erzwingen, was der politische Wille verweigert. Oder, zugespitzt: Ab 2026 reicht Nichtstun nicht mehr – es ist rechtswidrig.

Petition: Mobilitätswende in Hamburg konsequent fortsetzen
Dein Beitrag zählt: Diese Petition allein verändert nicht die Welt – aber sie zeigt Haltung. Und je mehr mitmachen, desto mehr bewegt sich.
👉 Jetzt auf weact.campact.de unterzeichnen